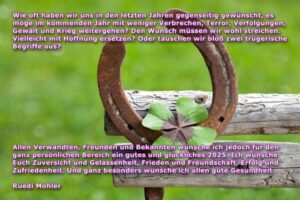Heute, am 11. Februar 2026, wäre der berühmte französische Spitzenkoch Paul Bocuse 100 Jahre alt geworden.

Wir haben ihn in seinem Restaurant in Collonges-au-Mont-d‘Or nördlich von Lyon im September 1975 das erste Mal erlebt. In doppeltem Sinne, wir hatte seine Küche genießen dürfen und er war sogar im Haus, machte später am Abend die Runde bei den Gästen und blieb bei uns zu einem Gespräch stehen. Wir hatten die außerordentliche Gelegenheit, ihm ein paar Fragen zu stellen und einen Austausch zu pflegen. Für uns war es das erste Haus, das mit drei Michelin-Sternen dekoriert war. Für uns ist das heute noch unser Einstieg in die Welt der ganz hohen Kochkunst.
Ich habe sogar ein paar Einzelheiten in bester Erinnerung. Die«amuses bouche» waren von großer Raffinesse, sehr fein gearbeitet und ein unwiderstehlicher Einstieg in einen großen Abend. Ebenso waren dann am Schluß des Menus die «friandises» von der selben großen Klasse. Unvergessen bleibt die «soupe aux truffes noires VGE», manchmal auch «soupe Elysée» genannt. Das war eine Kreation von Bocuse anfangs des Jahres. Der neue französische Staatspräsident Valérie Giscard d’Estaing, oft einfach VGE genannt, gab am 25. Februar 1975 ein Bankett im Élysee aus Anlaß seiner Ernennung zum Chevalier de la Légion d’Honneur. Zum großen Menu, an dem verschiedene Spitzenköche mitwirkten, steuerte Paul Bocuse diese spezielle Suppe bei. In einer consommé double werden Karotten, Zwiebeln, Sellerie und Champignon gekocht. Dazu gegeben wird Rindfleisch vom Schulterstück, blanc du poulet und vor allem foie gras und schwarzer Trüffel. Die Suppe wird in einem Suppentöpfchen serviert, auf das man einen Deckel aus Blätterteig legt und das Ganze im Ofen aufbäckt. Der Gast klopft dann die Blätterteighaube ein und ein wirklich köstlicher Duft von Fleischbrühe, Gemüsearomen, foie gras– und Trüffelduft strömt einem direkt in die Nase. Unvergeßlich!
Bocuse verstand nicht nur das Kochen, er war vielleicht der erste in der Kochbluse, der auch ganz genau gewußt hatte, wie man sich selbst vermarkten muß.
Bocuse wird eine der größten Persönlichkeiten der hohen Gastronomie bleiben, auch wenn ihn Kollegen und Konkurrenten aus der gleichen Altersklasse und vor allem auch Unzählige aus dem Nachwuchs doch bald einmal überholt hatten.
Eine Hommage gebührt ihm heute noch, denn er hat unglaublich viel für die Entwicklung einer exzellenten Kochkunst geleistet.
11.02.2026 RM